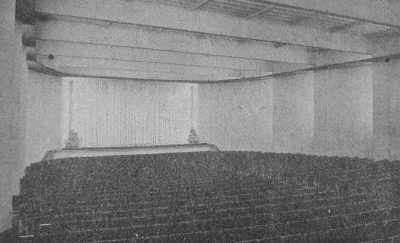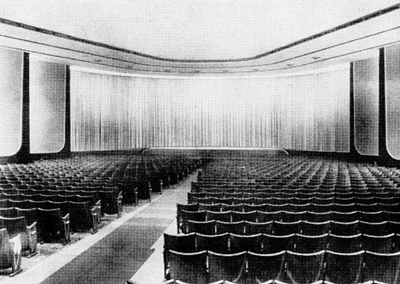Köln (Nordrhein-Westfalen),
Hahnenstr. 57
| eröffnet: |
18.08.1948 |
| geschlossen: |
30.05.1971
|
| Sitzplätze: |
1501 (1949/1958) - 1455 (1967) |
| Architekt: |
Wilhelm Riphahn (1948) - Hanns Rüttgers (Umbauten 1955 und 1958)
|
| Betreiber: |
Willi
Wolf 1948-mind.1967 |
Am Eingang der
Hahnenstraße befand sich ein riesiges Lichtspieltheater, die Hahnentor
Lichtspiele. Der Kinosaal war eine verkleidete Stahlkonstruktion, vor der dieses
repräsentative Eingangsgebäude stand. Bei dem Stahlbau konnte man auf eine Halle
zurückgreifen, die im Rohbau in der Messe für eine für 1940 geplante
Verkehrsausstellung errichtet worden war. In Deutz montierte man sie ab und
baute sie hier wieder auf. Das Kino war das größte in Köln mit 1500 Plätzen und
wurde 1948 mit dem Film "Das Lied von Bernadette"
eröffnet.
Das Theater trug den Namen
nach dem mittelalterlichen Gemäuer gegenüber, wenn es auch den denkbar möglichen
Gegensatz zum berühmten Hahnentor darstellte. Das Werk des Architekten Riphahn
war äußerste Sachlichkeit, die ihr Gesetz aus der Bestimmung des Baues
ableitete. Die Vorderseite war ein scharf geschnittenes Viereck. gegliedert im
oberen Teil durch die dreifach unterteilte hohe Fensterwand, durch die unter
einen Vorsprung durchgezogene Flucht der Türen, während links und rechts niedere
Anbauten die strenge Linie auflockerten. Nach einer weiteren Türreihe, befand
sich der Umgang. Er schwang im leichten Bogen um den Hintergrund, stieß
gradlinig an den Seiten vor, gabelte sich aber vorher in einen zweiten zum
Ausgang führenden, weich auskurvenden Gang (die Kurve war Stilprinzip in diesem
Bau). Der Trennung von Ein- und Ausgang entsprach auch die originelle Anlage der
Garderoben. Sie bildete ein Halbrund, dessen Innenseite für die Ankommenden,
dessen Rückseite für die Weggehenden bestimmt war. Es gab so keinen Gegenstrom
und kein Gedränge.
Dieser Ouvertüre entsprach der Theaterraum mit seinen
1500 Plätzen. Er blieb in der Ebene, nur hinten wölbte sich die Fläche stärker
hoch. Starre Wände gab es nicht. Seitlich standen Wandteile wie Kulissen
hintereinander geordnet, und an ihren Schnittpunkten waren die Zugänge. Vorn zur
Bühne hin schwang die "verzahnte" Wand in einem Halbrund aus, das vom
Bühnenvorhang aufgenommen wurde. Die Decke war in Kassetten aufgeteilt, mit
gewölbten Rückwänden, aus denen indirektes Licht fiel.
Der Vorführraum mit
zwei Bauer-VIIl-B-Projektoren hatte eine Fülle von Luft. Die Bühne war geräumig
und hatte Platz für große Orchester. Betreiber Willi Wolf gab am
Eröffnungsabend mit der Begrüßung auch seine Vision aus: den Platz Köln zu
einem Mittelpunkt für Westen zu machen und an dem bisher einseitigen
Uraufführungsruhm gewisser Städte (gemeint war wahrscheinlich das ewig
konkurrierende Düsseldorf) teilzunehmen. Direktor Goldschmidt von der MPEA
konnte sich persönlich davon überzeugen, daß dieser Ehrgeiz ein Fundament hatte.
Auch Kölns Oberbürgermeister Dr. Schwering schmunzelte, mit Vergnügen sich der
guten Akustik und des festlichen Anblicks des Raums hingebend, wobei er nicht
bloß an den Film, sondern auch an sein Gürzenich-Orchester dachte.
E4814
N4819
1955 präsentierte sich
Willi Wolfs Kino im neuen Gewand. Die Entwürfe zu dem in 25-tägiger Spielpause
großzügig renovierten Theater zeichnete der Düsseldorfer Architekt Hanns
Rüttgers. Zur festlichen Eröffnung mit dem in Uraufführung gestarteten Film 2...
und nichts als die Wahrheit" konnte der Hausherr zahlreiche Ehrengäste begrüßen.
Eine lichtdurchflutete, in hellblauen und gelben Farben gehaltene Kassenhalle
empfing die Besucher. Blickpunkt im Zuschauerraum bildete der 25 Meter breite
schwungvolle Hauptvorhang aus gestreiftem violettem und blauem Velvet, der aus
dekorativen Gründen rechts und links über die Bühnenöffnung vorgezogen wurde.
Die Seitenwände waren mit violettem, perforierten Kunstleder bespannt, das sich
wirkungsvoll von der in dunklem Nußbaumton gehaltenen Vertäfelung absetzte, die
pfeilerartig hochgeführt war. Repräsentativ wirkte auch die abgestufte
pastelgetönte Rigipsdecke, die die Sägeschnittaufteilung der Seitenwände aufnahm
und in besonderer Weise zur Raumatmosphäre beiträgt. Die Rückwand über dem
hochgelegenen Teil des Parketts war mit gefälteltem violetten Kunstseidenstoff
verkleidet. Geschmackvolle Pendelleuchten sowie die indirekte Anstrahlung des
Vorhangs und der Wände tauchten den Saal in ein angenehmes Licht. Die
formschöne, mit blauem Cord bezogene Hochpolsterbestuhlung montierten Schröder
& Henzelmann. Die attraktive Neonreklame an der Eingangsfront installierte
die Kölner Firma Efra.
Technisch wurden die Lichtspiele durch den
Einbau einer Vierkanal-Magnetton-Anlage modernisiert Neben einem
Klangfilm-Gestellverstärker GS 40, gelangten Vorverstärker mit Kassetten für
Magnetton, Lichtton, Mikrophon- und Schallplatten-Übertragung sowie eine ca. 15
m breite Gigant-Bildwand zur Aufstellung. Ferner wurden drei
Lautsprecher-Kombinationen auf der Bühne und eine Anzahl Effekt-Lautsprecher
montiert sowie Zeiss Ikon-Objektiveft und Anamorphoten geliefert.
N5549+65 W5536
1958 erhielt das Theater unter
anderem eine neue Hochpolsterbestuhlung, eine neue Decke und eine Klimaanlage.
An der Außenfront war eine neue Neonreklame zu sehen, die neuzeitlich gestaltete
Kassenhalle und die Vorräume waren farblich in Blau- und Gelbtönen gehalten.
Der Theatersaal wurde von einem über 25 m breiten Vorhang in violettem und
blauem Velvet, der weit in die Seiten vorgezogen war, dominiert. Die abgestufte
Decke nahm die Sägeschnittaufteilung der Wände auf. Die Wandflächen erhielten
eine violette, perforierte Kunstlederbespannung, die sich harmonisch von der in
dunklem Nussbaumton gehaltenen Vertäfelung, welche seitlich pfeilerartig
hochgeführt wurde, absetzte. Aus verdeckt angeordneten Lichtrasterfeldern vor
der Bühne fiel eine gewaltige Lichtfülle auf das große Halbrund des Vorhangs,
während die Seitenwände ebenfalls indirekt angestrahlt wurden. Pendelleuchten
über dem hochgelegenen Teil des Parketts gaben dem Raum eine eigenwillige Note.
Der Saal erhielt auch eine neue, durchgehende Hochpolster- Bestuhlung in
Dunkelnussbaum und dunkelblauem Bezugsstoff. E5866 N5849 W5835
Übrigens: Alte Kölner erzählen,
dass der Bau vor Allem mit Geldern aus Tabak- und Zigarettenschmuggel finanziert
wurde. Daher kam der Spitzname "Bosco" Kino nach einer damaligen
Zigarettenmarke. 1971
wurde das Haus geschlossen.
Weitere Informationen hier.


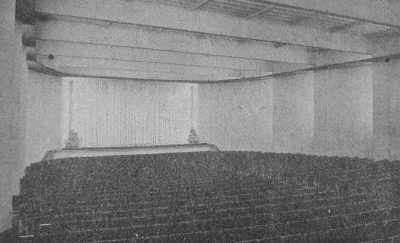
Bilder von 1948 (Fotoquelle: Filmblätter
28.09.48)
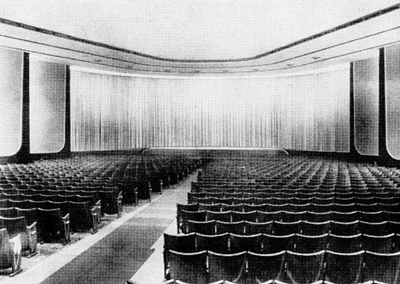
Saal 1955 (Bildquelle: Der Neue Film 49/1955)
weitere Fotos finden Sie hier, hier, hier
und hier
zurück zur Köln-Liste
zurück zur Liste Nordrhein-Westfalen
zurück zur Startseite
Impressum
und Datenschutzerklärung
Datum der Erstellung/letztes Update: 19.02.2025 - © allekinos.com